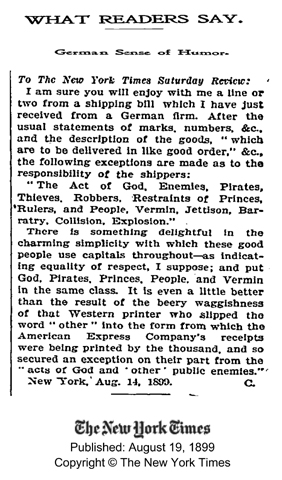Oscar Ogg: The 26 Letters
Thomas Y. Crowell Company, New York 1961, 1948
8. Auflage 1962
beg, bee: 31.07.2009-02.08.2009 u. 18.-19.08.2009
„The reason that the letter forms of many early designers are superior to their modern counterparts is that the modern letterers have attempted to arrive at the conclusions of the early designers without first having become acquainted with the sources of their results.“ (Oscar Ogg, zitiert in: Leslie Cabarga: Logo, Font & Lettering Bible, S. 78)
Der Liebe zum Schreiben entspringt dieses Buch, nicht im Sinne des literarischen Vollzugs, sondern als Ausführung und Gestaltung der Schrift zum eigenständigen Objekt von Kunstfertigkeit und Zeugnis des Schönen; und sein Autor, Oscar Ogg (1908-1971), gilt neben Paul A. Bennett und Warren Chappell als einer der herausragenden US-amerikanischen Schriftentwerfer, Graphiker und Illustratoren Mitte des 20. Jahrhunderts. The 26 Letters erschien erstmalig 1946 in kleiner, bibliophiler Auflage in New York, im gleichen Jahr, als Ogg dort die kalligraphische Abteilung an der Columbia-Universität begründete, und nimmt den Leser mit auf eine Reise von den vorgeschichtlichen Ursprüngen der Schrift in Skulptur und Höhlenmalerei bis zu dem uns vertrauten, in einer langen Entwicklungskette ausgeformten lateinischen Alphabet mit seinen 26 Buchstaben. Kursorisch folgt Ogg in sieben von neun Kapiteln der Geschichte des Abc mit einer Übersicht der konkurrierenden Schriftsysteme der alten Ägypter (hieroglyphisch, hieratisch, demotisch) und einem faszinierenden Exkurs über die (kolonial verwickelte, kollateral durch Napoleons Feldzug bedingte) Entdeckung und Entzifferung des Steins von Rosetta, beschreibt die Herausbildung des ersten wahren, des phönizischen Alphabets mit seiner Vermengung kretisch-minoischer und ägyptischer Einflüsse mit den Cuneiform der Völker Mesopotamiens (Assyrer, Babylonier, Hethiter) und zeichnet die Überführung der Schrift vom griechisch-römischen Zeitalter bis hin zur Moderne nach. Der karolingische Beitrag um die Minuskeln, die Sonderformen der Halbunziale auf den britischen Inseln und in der frühchristlichen Literatur Irlands, die stilistische Virtuosität der Manuskripte mönchischer Skribenten des Hochmittelalters finden ebenso Erwähnung wie, eingehend und archetypisch, die formvollendete Inschrift der im Jahr 113 in Rom errichteten Trajanssäule als erstem Höhepunkt europäischer Hochschriftkultur.
Ogg illustriert sein zentrales Argument, die Gestaltung der Buchstaben des Alphabets folge aus dem Werkzeug, das der jeweiligen Kultur zum Schreiben zur Verfügung stehe, ein ums andere Mal, wenn er die Keilschrift wortwörtlich nimmt, in deren Bezeichnung selbiger Zusammenhang genuin eingefaßt ist, wenn er die gerade Strichführung (früher) altgriechischer Buchstaben ableitet aus der Verwendung von Wachstafeln, in welche Notizen mit einem Griffel eingekratzt wurden, während die Nutzung von Papyrus und (später) auch Papier und Pergament schon der klassischen Antike weichere, geschwungenere Formen erlaubte, und wenn er die Beschriftungen griechischer Reliefs und Plastiken vergleicht mit der Blüte trajanscher Kapitalien, derer erstere noch mit geradem Schlag mit dem Meißel dem Stein abgerungen sind, während letztere zunächst aufgemalt und hernach in ihren Rundungen und Wölbungen vom Steinmetz raffiniert herausgearbeitet wurden, wobei die Römer, durch ihre Meißeltechnik genötigt, die Serifen herausbildeten. „The tool governs the form again [and again]“ (S. 213), konstatiert Ogg, und so bleibt die Bedeutung von Material und Instrumentarium für die Kulturtechnik des Schreibens auch Leitmotiv der zwei abschließenden Kapitel zur Geschichte des frühen Buchdrucks, welcher rasch die Entwicklung standardisierter Schrift-Lettern bedingte. Waren die ersten Vertreter des Druckhandwerks noch orientiert an mittelalterlichen Handschriften und regionalen Varianten des lateinischen Alphabets, gewannen binnen eines Jahrhunderts die zwei Formen Vorrang, die bis heute idealtypisch unseren Schriftzeichen unterliegen: Die gebrochenen Schriften, auch Gotische genannt (Fraktur, Schwabacher, Rotunda), die, da sie aufgrund ihres starken Strichs und ihrer gedrängten Gestalt die Buchseiten eng und dicht bedruckt erscheinen ließen: in Schwarz getaucht, im Englischen als Black-Letters bezeichnet werden, und die aus der Kombination humanistischer Minuskeln mit altrömischen Versalien entwickelten Antiquaschriften, letztere bereichert und erweitert durch die Italienische (Italic, echte Kursivschrift) des Aldus Manutius, des Meisters des venezianischen Renaissancebuchdrucks. (Einzig im deutschsprachigen Raum behauptete sich die Gotische bis ins 20. Jh. und fand, als Schreibschrift, in den deutschen Kurrentschriften (z.B. Sütterlin) ihre idiosynkratische Entsprechung.)
Ogg, ein meisterlich geschulter Kalligraph, hat sein Buch mit einer Vielzahl teils kolorierter Schriftbeispiele und Abbildungen versehen, die die mühevolle Geschichte von Schriftwerdung und -erzeugung anschaulich illustrieren; und auch jüngere Leser mögen dem Gedankengang Oggs in seiner einfachen, klar strukturierten Sprache trefflich folgen, nicht zuletzt weil im Erzählton sich die Begeisterung des Autors für das Phänomen des Schreibens vermittelt. Daß er, typographisch-typophil, den Schriftsatz Old Face William Caslons für den vorliegenden Text wählt: „No type of any time, however, has ever made a more attractive and readable page than the original type of Caslon [designed about 1724], [of which] you have an example of a modern redrawing of […] his honest, handsome letters before you now as you read this book“ (S. 239), belegt, wie sehr dem Verfasser die Schreibkunst eine ars amandi war. Was sagte wohl dieser bibliophile Traditionalist zu den heutigen Schriftarten, wie sie moderne Dokumente, ergonomisches Online-Publishing prägen? So bestätigt er sich angesichts PC-gestütztem Schriftdesigns fände in seiner These: Form qua Funktion und Werkmaterial, hieße er sie vielleicht serifen-, charakter- und seelenlos? Produkte tachogener Weltfremdheit? Im nahezu unerschöpflichen Variantenreichtum rechnerbasierter Alphabete finden sich nur wenige, die dadurch bestechen, wie ausgewogen, formschön und elegant sie gestaltet sind. Und so faßt das vorangestellte Zitat, kolportiert vom Fontdesigner Leslie Cabarga, die Arbeitsethik und -technik des Oscar Ogg vielleicht am treffendsten: Nur das Nachvollziehen der Geschichte des Schreibens lehrt das Schreiben selbst.
(7), 262 Seiten, Festeinband
engl.-sprachig
Buchdruck, Typographie, Europa